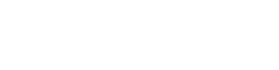Nachbericht zu Bio. Innovationen. Stärken. | Die Farben der Biotechnologie – Grün und Blau am 13.05.2025
Neue Einblicke in die Welt der Pflanzen und aquatischen Organismen
Im ersten Block der Online-Veranstaltung drehte sich alles um das Reich der Pflanzen und wie dieses die Biotechnologie vorantreibt. Biotechnologie in Pflanzen zu betreiben hat viele Vorteile und sie werden heutzutage vielfältig eingesetzt: ob zur Gewinnung von Wirkstoffen für Medikamente, zur Herstellung nachhaltiger Produkte oder als Nahrungsquelle.
Einen Überblick über die Grüne Biotechnologie und Pflanzenzüchtung lieferte Herr Dr. Robert Hoffie vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Er fasste die Geschichte der Pflanzenbiotechnologie, die ihren Ursprung bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, zusammen, und erklärte in seinem Vortrag, welche verschiedenen Methoden es gibt, Wunschproteine in Pflanzen produzieren zu lassen.
Daran anknüpfend befasste sich der Vortrag von Dr. Frank Thieme damit, wie man in Tabakpflanzen Wirkstoffe für den klinischen und diagnostischen Einsatz herstellen kann. Die Firma Icon Genetics aus Halle an der Saale nutzt hierfür das Bakterium Agrobacterium tumefaciens, das in der Lage ist, genetische Informationen in Pflanzenzellen einzuschleusen. Die Zelle produziert daraufhin das gewünschte Protein. Auf diese Weise produzierte Icon Genetics beispielsweise auch einen Anitkörpercocktail während des Ebola-Ausbruchs 2014.
Doch nicht nur die Biotechnologie mithilfe von, sondern auch für Pflanzen zählt zur Grünen Biotechnologie. Das von BASF entwickelte Insektizid Inscalis® wird hauptsächlich durch einen biotechnologischen Fermentationsprozess hergestellt und verfügt über ein günstiges Umweltprofil, da die Anzahl nötiger Produktionsschritte im Vergleich zu einer rein chemischen Synthese reduziert werden konnte. Zusätzlich müssen vom Endprodukt nur sehr geringe Mengen ausgebracht werden, um Nutzpflanzen vor saugenden und stechenden Insekten zu schützen, während Bienen nicht von der Wirkung betroffen sind. Dr. Hartwig Schröder erwähnte außerdem, dass sich eine der Fermentationsanlagen für das Ausgangsprodukt in Hessen befindet.
Das Projekt von Dr. Schulze Gronover vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME) in Münster war bereits für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Zusammen mit seinen Kooperationspartnerinnen und -partnern hat Dr. Schulze eine nachhaltige Quelle für Naturkautschuk entdeckt, der unter anderem für die Herstellung von Reifen verwendet wird. Momentan wird fast der komplette Naturkautschuk in Asien bzw. Südamerika gewonnen. Als nachhaltigere Alternative kann jedoch auch eine bestimmte Löwenzahnart in unseren Breitengraden angebaut werden, die in ihrem Milchsaft ebenfalls einen hohen Kautschukanteil enthält.
Der letzte Vortrag zur Pflanzenbiotechnologie zeigte auf, wie Grünschnitt genutzt werden kann, um die Weiße Biotechnologie voranzutreiben. Prof. Dirk Holtmann vom Karlsruher Institute of Technology stellte in diesem Zusammenhang die beiden Projekte „Green to Green“ und „Green Pro Scale“, Innovationsprojekte aus dem Innovationsraum BioBall (Bioökonomie im Ballungsraum Rhein-Main), vor. Wird Grünschnitt gepresst, kann der Presssaft für unterschiedliche biotechnologische Zwecke verwendet werden: zum einen kann er als nachhaltiges Nährmedium für Bakterien im Labor genutzt werden, zum anderen können aus dem Saft direkt Enzyme für biotechnologische Anwendungen gewonnen werden.
Auch die Vorträge zur Blauen Biotechnologie lieferten einen tiefen Einblick, wo aquatische Lebewesen heute bereits zum Einsatz kommen und welche Schätze noch auf dem Meeresboden warten.
Eine sehr gute Zusammenfassung lieferte der Einstiegsvortrag von Dr. Dr. Henrike Seibel vom Fraunhofer Institut für Individualisierte und Zellbasierte Medizintechnik (IMTE), Büsum, in die Thematik. Sie definierte die Blaue Biotechnologie als wirtschaftliche und ökologische Nutzung der Meereswelt und nannte drei Praxisbeispiele: die Gewinnung gesundheitsfördernder Stoffe aus Purpurbakterien für die humane und die Tierernährung, die nachhaltige Kultur von Makroalgen zur Gewinnung von kosmetischen Zusätzen sowie die Erhöhung des Omega-3-Fettsäuregehaltes von Fisch durch die Verfütterung von pflanzlichen Alternativen zur konventionellen Fütterung mit Fisch. Sie betonte außerdem, dass der nachhaltigste Weg für die Blaue Biotechnologie der Zukunft die Kultivierung mariner Organismen an Land sei, um Eingriffe in empfindliche Ökosysteme zu minimieren.
Genau mit diesem Thema beschäftigte sich der Vortrag von Hans Väth. Seine Firma Algoliner aus dem hessischen Messel hat einen speziellen Bioreaktor zur nachhaltigen Kultivierung von Mikroalgen entwickelt. Die hierfür nötigen Plexiglasrohre können vor Ort direkt aus einer mobilen Fabrik heraus produziert werden, was Kosten für Verpackung und Transport spart. Zusätzlich sind die Rohre recyclebar, mit aseptischen Flanschen verbunden und das System ermöglicht die Einspeisung von Kohlenstoffdioxid aus Biogasanlagen, was den Einsatz im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ermöglicht.
Mikroalgen standen auch im Mittelpunkt des Vortrages von Dr. Michael Paper von der Technischen Universität München. Im Münchener Algentechnikum können unterschiedliche Anzuchtbedingungen für Algen simuliert und optimiert werden. Das ermöglicht es vor Ort zu testen, wie ertragreich eine Algenkultur beispielsweise an der spanischen Küste wäre. Ziel der Algenkultur ist die Produktion von nachhaltigem Biodiesel mithilfe von ölproduzierenden Mikroalgen.
Auch der letzte Vortrag des Tages unterstrich das vielfältige Potenzial von marinen Organismen im Sinne der Blauen Biotechnologie. In ihrem gemeinsamen Vortrag präsentierten Dr. Joachim Henjes vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven und Prof. Tobias Schatton, Harvard Medical School, der gleichzeitig wissenschaftlicher Beirat der Firma KliniPharm aus Eschborn in Hessen ist, die vielfältige Nutzung von Substanzen aus marinen Schwämmen. Aus diesen Organismen kann nämlich nicht nur Kollagen gewonnen werden, sondern auch neue antibiotisch wirksame Substanzen, gegen die bisher noch keine Resistenzen bekannt sind. Jährlich werden 750 neue marine Substanzen und Wirkstoffe entdeckt, von denen die Hälfte aus Schwämmen kommt. Diese sehr vielseitigen Lebewesen bieten noch ungeahnte Möglichkeiten für den Einsatz für Diagnostik und Therapie.
Insgesamt bot das Programm überraschende Einblicke in die Welt der Pflanzen und marinen Organismen und zeigte auf, wie diese die Grüne und Blaue Biotechnologie der Zukunft mitgestalten.
Die nächste Veranstaltung findet am 02. Juli 2025 ebenfalls als Onlineveranstaltung statt und wird sich schwerpunktmäßig mit den beiden bekanntesten Farben der Biotechnologie, der Roten, medizinischen, und der Weißen, industriellen, Biotechnologie, beschäftigen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!