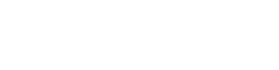Nachbericht zu Bio. Innovationen. Stärken. | Die Farben der Biotechnologie – Rot und Weiß am 02.07.2025
Einblicke in neue Entwicklungen der Pharmazeutischen Biotechnologie
Der erste Teil der Veranstaltung befasste sich mit der Roten Biotechnologie, in der sich alles um den Einsatz von Mikroorganismen, Zellen, Enzymen und biologischen Wirkstoffen dreht und wie diese die Medizin voranbringen. Dazu berichteten fünf Gäste über neueste Entwicklungen in ihren Unternehmen oder Forschungseinrichtungen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Jennifer Arndt vom Technologieland Hessen, stieg Dr. Andrea Belluati, derzeitiger Emmy-Noether-Gruppenleiter an der TU Darmstadt, mit einem spannenden Vortrag zu synthetischen Zellmembranen und Zellen ein. Zellmembranen trennen Bakterien von ihrer Umwelt und bieten ihnen somit Schutz vor verschiedenen Umwelteinflüssen. Die Membranen müssen bestimmte Eigenschaften haben, um der Zelle das Leben zu ermöglichen. Sie müssen semipermeabel sein, um den Stoffaustausch mit der Umgebung zu ermöglichen, ohne dass alle Stoffe ungehindert in oder aus der Zelle strömen können. Sie müssen sowohl stabil als auch flexibel sein, damit der Zellinhalt einerseits von der Umgebung abgetrennt und geschützt ist, aber auch Erschütterungen aushalten und abfedern kann, ohne dass die Zelle direkt zerstört wird. In seiner Forschung konzentriert sich Dr. Belluati einerseits auf die Modifizierung lebender Zellen, um verschiedene Eigenschaften optimieren zu können. Mit Methoden aus den Bereichen der Synthetischen Biologie, Polymerchemie und Biomaterialwissenschaften modifiziert sein Team Bakterien, um diese resistenter gegenüber Umwelteinflüssen zu machen. Erste Erfolge konnten bereits gezeigt werden:
So konnten die Bakterien mit synthetischen Membranen ummantelt werden, wodurch sie Temperaturschwankungen besser aushielten. Doch das Team von Dr. Belluati beschäftigt sich nicht nur mit der Modifizierung lebender Zellen. Ziel ist auch, synthetische Zellen beziehungsweise hybride lebende Systeme zu erschaffen. Dazu untersucht die Forschungsgruppe, ob sie die synthetischen Membranen mit verschiedenen Bestandteilen lebender Zellen ausstatten kann und wie stabil diese Systeme sind. Um gezielt in der Umweltbiotechnologie oder Biokatalyse eingreifen zu können, ohne Nebenprozesse in der Zelle ablaufen zu haben, versucht das Team zum Beispiel hybride Systeme aus synthetischen Membranen und Enzymen zu erschaffen. Diese synthetischen Katalysatoren könnten dann zum Beispiel genutzt werden, um gezielt Verschmutzungen abzubauen.
Doch nicht nur Zellmembranen können verändert werden, sondern auch andere Bestandteile von Zellen. Nonribosomale Peptid Synthetasen (NRPS) funktionieren wie kleine Maschinen in mikrobiellen Zellen. Sie bestehen aus einzelnen Modulen, die in einem großen Komplex sehr effizient und spezifisch zusammenarbeiten. NRPS bauen unter anderem aus verschiedenen Aminosäuren sehr komplexe chemische Strukturen auf, die von großem medizinischem Interesse sein können: Weil immer mehr Antibiotikaresistenzen unser Gesundheitssystem bedrohen, möchte das iGEM –Team der Philipps-Universität Marburg diese zellulären Maschinen nutzen, um neue Antibiotika herzustellen. Das diesjährige iGEM-Team, vertreten durch Yaro Fokken, stellte das Projekt NRPieceS für den „international Genetically Engineered Machine“ Studierendenwettbewerb vor, bei dem es verschiedene NRPS aus Mikroben gentechnisch modifizieren oder einzelne Module der Synthetasen austauschen möchte. Mit KI-Unterstützung und einem hohen Durchsatz verschiedener Kombinationen ausgetauschter Module möchten die Gruppe neue bisher unbekannte Antibiotika finden.
Anschließend ging Dr. Bernd Hoffmann, Geschäftsführer der SRTD Biotech GmbH, Jülich auf die Entwicklung von selektiv exprimierbaren RNA-Molekülen für therapeutische Anwendungen ein. Durch bioinformatische Analysen konnte das Unternehmen DNA-Sequenzen finden, die sich in manchen Krebszellen von denen gesunder Zellen unterscheiden. Diese Marker Sequenzen sind nutzbar, um eingeschleuste mRNA in der Zelle zu aktivieren. Als mRNA bezeichnet man kleine Botenstoffmoleküle, die für die Produktion von Proteinen in der Zelle notwendig sind. Wird mRNA in eine Zelle eingeschleust, wird diese dort in Aminosäuren umgeschrieben und die Zelle produziert daraus neue Proteine, die sie ohne die eingeschleuste mRNA nicht produzieren könnte. Während herkömmliche mRNA-Wirkstoffe in allen Zellen aktiv sind und somit potenziell alle Körperzellen die Proteine, die auf der mRNA codiert sind, bilden, hat SRTD Biotech GmbH eine neue Technik entwickelt:
Durch das Erkennen bestimmter DNA-Marker-Sequenzen in den Krebszellen, wird die eingeschleuste mRNA nur in genau den Zellen aktiviert, in denen die veränderte Marker-DNA vorliegt, also den Krebszellen. Somit werden nur in den Krebszellen die Proteine produziert, die auf der mRNA beschrieben sind, während alle gesunden Zellen die eingeschleuste mRNA wieder abbauen, ohne die Proteine zu produzieren. Die in den Krebszellen produzierten Proteine können dann die Krebszellen von innen angreifen und zerstören. Erste Tierversuche zeigten vielversprechende Ergebnisse. Nach einer einmaligen Gabe an Mäuse, die an einem Glioblastom erkrankte waren, konnte nach 14 Tagen eine starke Reduktion um 60 Prozent beobachtet werden. Diese neue Technik könnte die Krebstherapie stark vorantreiben.
Die Relevanz von Private-Public-Partnerships
Einen anderen Blickwinkel auf die pharmazeutische Biotechnologie bot Frau Dr. Claudia Tredup. Die Wissenschaftskoordinatorin des „Structural Genomics Consortium“ (SGC) an der Goethe-Universität Frankfurt stellte die Arbeiten dieser globalen Public-Private Partnership Initiative vor. Das SGC vereint momentan 250 Wissenschaftler und über 350 Mitarbeiter in einem globalen Netzwerk. Mit einer offenen Wissenschaft und einem Kein-Patent-Paradigma, schaffen die Mitglieder des Konsortiums Wissen und Reagenzien, wie Proteinstrukturen und chemische Substanzen, die von allen Wissenschaftlern frei genutzt werden können. Durch diese offene Form der Wissenschaft fördert das SGC den Austausch zwischen akademischer Forschung und Industrie, um neue Medikamente zu entwickeln. Auf diese Weise konnten bereits über 100 neue Medikamente in klinische Studien gehen. Auch immer mehr Pharmaunternehmen zeigen Interesse an dieser Form des Wissensaustauschs. Als eines der größten und bereits am längsten bestehenden Konsortien möchte SGC die Funktion aller menschlichen Proteine verstehen, um damit die Entwicklung neuer Medikamente vorantreiben zu können. Anhand von Beispielen zeigte Dr. Tredup, dass sich die Forschung häufig auf dieselben Zielproteine bezieht und selten Neues untersucht. Sie zeigt, dass ein Umdenken nötig ist und ein offener wissenschaftlicher Austausch zwischen Industrie und Forschungsinstituten, damit die Forschung Früchte tragen und neue Medikamente hervorbringen kann.
Thematisch dazu passend stellte Prof. Jochen Maas die Initiative Gesundheitsindustrie Hessen (IGH) vor. Die 2013 gegründete Initiative bringt die unterschiedlichen Akteure aus dem Bereich der Gesundheitsindustrie, also Politik, Akademie, Industrie und Sozialpartner, zusammen, um die Gesundheit und Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dabei gehen sie praxis- und dialogorientiert verschiedene Themen an. Dazu gehören Standortsicherung, Digitalisierung, sichere bzw. stabile Lieferketten, Sicherung der Wertschöpfungskette aber auch Förderung von Public-Private-Partnerships und interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Neue Chancen der industriellen Biotechnologie
Der zweite Teil der Veranstaltung befasste sich mit der Weißen, industriellen Biotechnologie. In dieser werden Enzyme oder Mikroorganismen als Katalysatoren für chemische Prozesse genutzt, um zum Beispiel industrielle Abfallstoffe einer Kreislaufwirtschaft zuzuführen oder Produktionsprozesse energie- und ressourceneffizienter zu gestalten.
Dr. Adam Franz, Geschäftsführer der CropEnergies Biobased Chemicals GmbH, Elsteraue stellte Lösungen zur Defossilierung des Verkehrssektors durch die Herstellung von Bioethanol vor. Als Teil der Südzucker-Gruppe sucht das Unternehmen nach Lösungen, wie verschiedene Biomasse zu einem breiten Portfolio an Produkten verwertet werden kann, um effizient landwirtschaftliche Flächen nutzen zu können. Das so nachhaltig gewonnene Bioethanol aus Getreide oder Zuckerrüben kann als erneuerbarer Kraftstoff zur Benzin-Beimischung genutzt werden und somit zu mehr Unabhängigkeit von Rohölpreisen und fossilen Importen beitragen. In der anschließenden Diskussion wurden weitere relevante thematische Aspekte aufgegriffen – etwa die Frage nach dem Ertrag aus dieser Nutzung der Biomasse und ob einfache Landwirte hier gewinnbringend investieren könnten. Die Diskussion zeigte, dass die involvierten Prozesse teuer sind und die Prozesse der Bioethanolgewinnung sich wirtschaftlich nur in Kombination mit anderen bioökonomischen und verarbeitenden Prozessen lohnen.
Zum Abschluss berichtete Moritz Tettenborn von CO2BioClean aus Eschborn, wie CO2 Nebenströme aus der Industrie in einer Kreislaufwirtschaft genutzt werden können. CO2BioClean hat einen neuen Weg gefunden CO2-biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe herzustellen, und möchte damit die Zukunft der Kunststoffherstellung mitgestalten. Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die verschiedenen Funktionalitäten, wie eine hohe Langlebigkeit, günstige Preise, Flexibilität oder auch Starrheit haben Kunststoff seit den 50er Jahren im Alltag etabliert. Mit anderen Materialien können bestimmte Eigenschaften nicht erreicht werden, wie zum Beispiel sterile Verpackungen von Medizinprodukten. Kunststoffe sind somit unentbehrlich geworden. Aber genau die Eigenschaften, die die Kunststoffe einst zu einer Goldmine werden ließen, kommen immer mehr in Verruf. Das von CO2BioClean hergestellte Bioplastik aus Polyhydroxyalkanoaten (PHA) hat dieselben Eigenschaften wie herkömmliche Kunststoffe. Allerding ist es gegenüber herkömmlichen Kunststoffen eine nachhaltige Alternative. Die Herstellung ist milder und nachhaltiger, da zu Herstellung Bakterien genutzt werden, die aus CO2-Abfallströmen aus der Industrie diesen Kunststoff aufbauen. Somit wird es auch aus zirkulären Ressourcen gewonnen. Da PHA kompostierbar ist und von Mikroorganismen wieder abgebaut und verwertet werden kann, stellt es keine Verschmutzung dar und bleibt nicht als Mikroplastik zurück. PHA könnte somit viele momentan genutzte Kunststoffe ablösen und zum Beispiel Anwendung in der Kosmetik-, oder Textilindustrie sowie als Verpackungen finden. Das junge Unternehmen ist nun dabei Partner zu finden, die auf diese umweltfreundliche Alternative umsteigen wollen und produziertes CO2 zu einem nachhaltigen Kunststoff umwandeln möchten.
Die nächste Veranstaltung findet am 21.Oktober 2025 in Gießen statt. Freuen Sie sich auf viele spannende Einblicke in die krabbelnde und summende Welt der Gelben Biotechnologie, die unter anderem den Einsatz von Insekten in der Biotechnologie thematisiert.